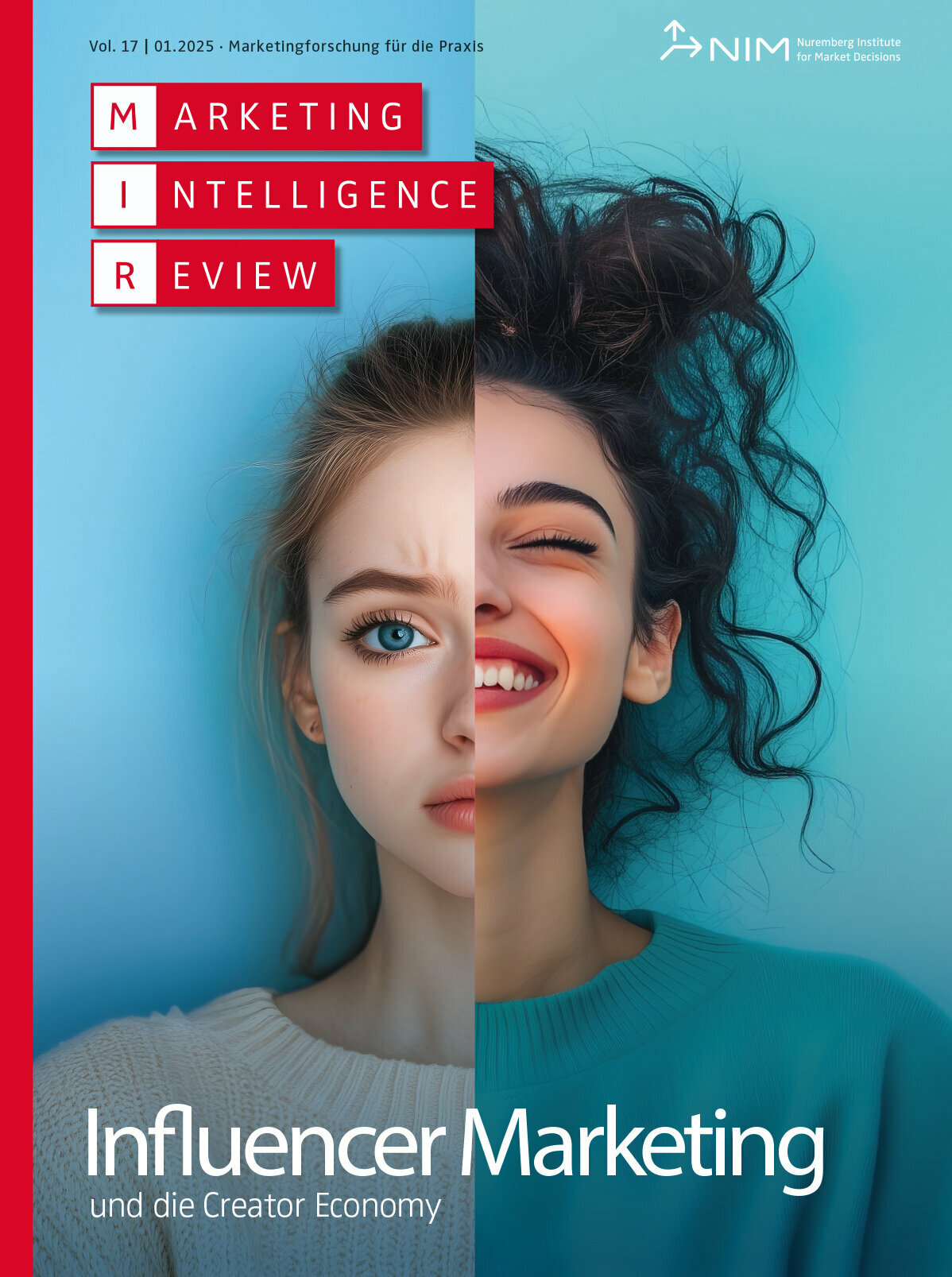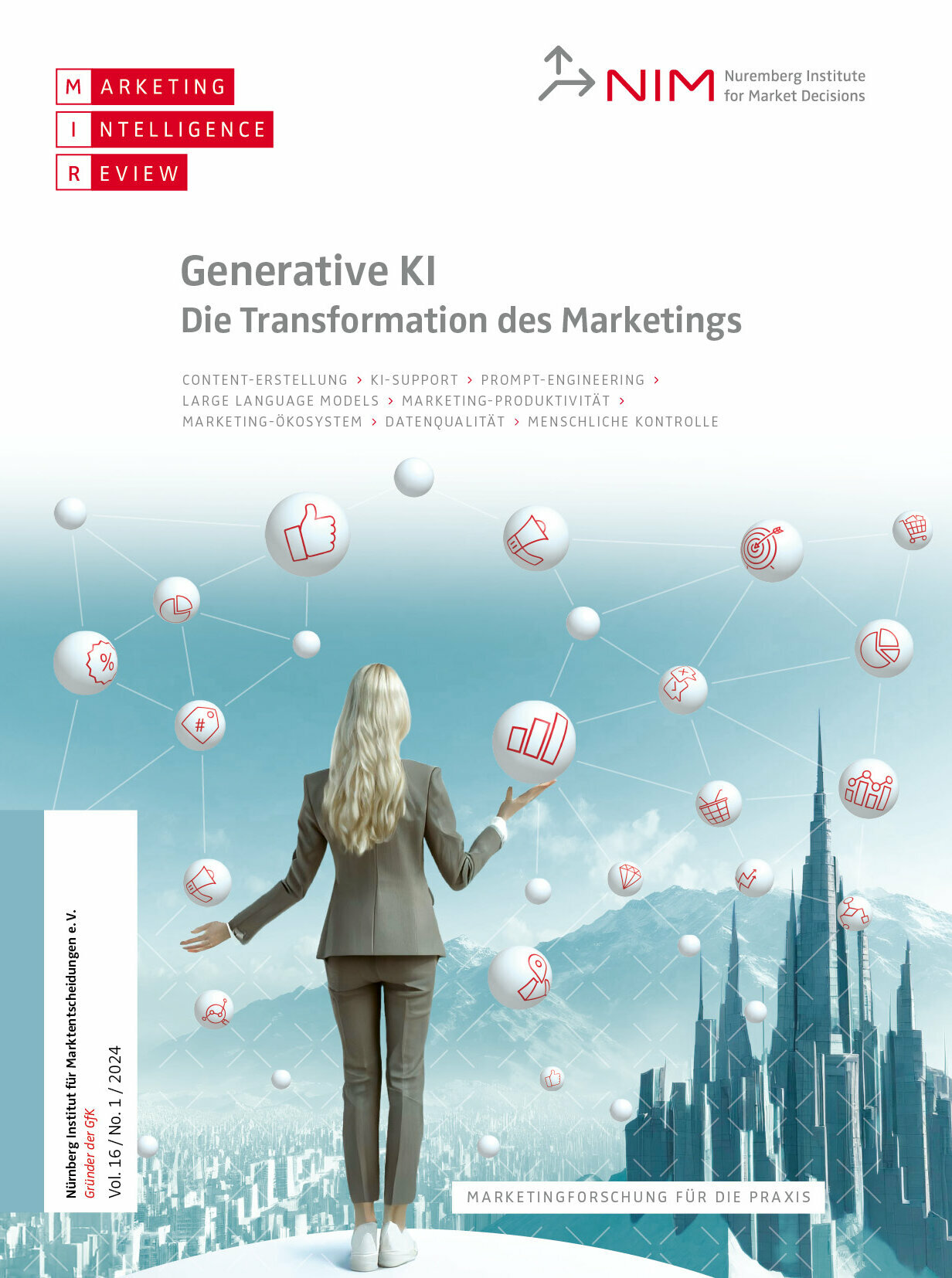Die Kommentarfunktion sperren? Wie Influencer, Plattformen und Marken mit negativen Kommentaren umgehen können
Wer als Influencer erfolgreich sein will, muss sich interessiert, authentisch und nahbar zeigen und Followern das Gefühl vermitteln, ein echter Freund oder eine gute Freundin zu sein. Die Follower und Followerinnen erwarten einen persönlichen Austausch und möchten auch eigene Gedanken, Gefühle und Ansichten äußern. Viele tun das, indem sie Influencer-Posts kommentieren. Doch diese Nahbarkeit macht verletzbar und kann für Influencer zur Gefahr werden. Im besten Fall sind die Reaktionen von Konsumenten ermutigend, sie können jedoch auch in Cyber-Mobbing ausarten – mit ernsthaften Folgen für die psychische Gesundheit der Influencer und Influencerinnen. Der Kommentarbereich der Social-Media-Plattformen wird oft als Sprachrohr für Beleidigungen und Verleumdungen genutzt, wobei Hatespeech jeden verstören kann, nicht nur Influencer. Tatsächlich lassen sich zahlreiche Selbstmorde von Celebrity- und Social-Media-Influencern auf Hasskommentare im Internet zurückführen.
Um die Sicherheit und die mentale Gesundheit ihrer Nutzer zu erhöhen, haben Social-Media-Plattformen die Möglichkeit geschaffen, die Kommentarfunktion zu deaktivieren und Reaktionen zu verhindern, sodass andere Personen keine Möglichkeit mehr haben, auf Posts zu reagieren. Immer mehr Influencer wie Hailey Bieber und Addison Rae haben diese Option genutzt, entweder für einzelne Beiträge oder ihren gesamten Account. Bei Konsumenten und Konsumentinnen, die von Influencern Nahbarkeit und Interesse erwarten, stößt das allerdings meist auf wenig Begeisterung. Abbildung 1 stellt Vor- und Nachteile gegenüber, die mit der Deaktivierung der Kommentarfunktion durch Influencer einhergehen können.
Konsumenten, die Posts von Influencern nicht mehr kommentieren können, sind weniger bereit, deren Markenpartnerschaften zu unterstützen.
Was es bedeuten kann, Kommentare zu unterbinden
Wir haben untersucht, wie Konsumenten reagieren, wenn Influencer die Kommentarfunktion deaktivieren, und was das für die Markenpartner bedeutet.
> Influencer werden negativer wahrgenommen
Wenn Influencer die Kommentarfunktion für ihre Posts deaktivieren, berauben sie Konsumenten ihrer effektivsten Möglichkeit, sich zu äußern. Anhand eines Datensatzes von Twitter/X haben wir in sechs Experimenten unter anderem herausgefunden, dass das nicht gut ankommt. In einem Experiment haben wir einen Satz von 1000 Tweets, in denen thematisiert wurde, dass ein Influencer seine Kommentarfunktion deaktiviert hatte, mit einem Kontrollsatz verglichen. Das Ergebnis: Die Tweets über unterbundene Kommentare waren deutlich negativer. Ein weiteres Experiment zeigte, dass sogar dann, wenn die sichtbaren Kommentare größtenteils negativ waren, eine Influencerin mit deaktivierter Kommentarfunktion im Vergleich negativere Reaktionen erhielt.
> Auch Markenpartnerschaften der Influencer sind negativ betroffen
Konsumenten, die Posts von Influencern nicht mehr kommentieren können, sind auch weniger bereit, deren Markenpartnerschaften zu unterstützen. In einem Experiment zeigte sich, dass die Teilnehmer deutlich weniger Interesse am Content der Marke hatten, wenn die Influencerin die Kommentarfunktion deaktiviert hatte, als wenn Kommentare möglich waren. Eine Folgestudie ergab Ähnliches: Hier waren die Teilnehmer bei gesperrter Kommentarfunktion weniger bereit, den Promo-Code einer Influencerin anzunehmen, weil sie das Gefühl hatten, die Influencerin sei an ihrer Meinung nicht interessiert, und deshalb an ihrer Glaubwürdigkeit zweifelten.

Wie lassen sich negative Reaktionen vermeiden?
Angesichts der negativen Folgen, die das Unterbinden von Kommentaren haben kann, stellt sich die Frage, wie Influencer und Influencerinnen auf ihr Wohlbefinden achten können, ohne die Beziehung zu ihren Followern und Markenpartnern zu gefährden. Wir haben festgestellt, dass Follower unter gewissen Bedingungen auch Verständnis dafür zeigen, dass Influencer „die Notbremse ziehen“. Wenn sie offen und ehrlich kommunizierten, dass Sondersituationen mehr Selbstschutz erfordern, etwa infolge eines Todesfalls oder bei psychischen Krisen, reagierten die Follower weniger negativ auf das Deaktivieren der Kommentarfunktion. Eine Influencerin teilte ihren Followern zum Beispiel offen mit, dass sie zu ihrem eigenen Schutz eine Verschnaufpause bräuchte, um sich psychisch zu stabilisieren. In diesem Szenario büßte sie nichts an Sympathie oder Glaubwürdigkeit ein, unabhängig davon, ob die Kommentarfunktion deaktiviert war oder nicht (siehe Abbildung 2).

Wie sich Influencer schützen können, ohne ihre Follower zu verstimmen
Ob Follower Influencer-Posts kommentieren können, beeinflusst nicht nur ihre Sympathie für den Influencer, sondern auch ihre Bereitschaft, beworbene Marken zu unterstützen. Doch wie können Influencer einerseits mit dem Mitteilungsbedürfnis ihrer Follower und andererseits mit der Notwendigkeit, zugänglich und glaubwürdig zu sein, umgehen, ohne ihre psychische Gesundheit zu gefährden? Und wie können sie Schaden von ihren Markenpartnern abwenden?
Wenn Influencer offen und ehrlich kommunizierten, dass Sondersituationen mehr Selbstschutz erfordern, reagierten die Follower weniger negativ.
> Self-Care als legitime Strategie kommunizieren
Ehrliche Kommunikation ist die Basis für eine gelungene Influencer-Follower-Beziehung. Soweit möglich sollten Influencer ihre Follower informieren, bevor sie Kommentare zu ihren Posts deaktivieren. Wenn sie offen kommunizieren, wie sich negative Reaktionen auf sozialen Medien auf ihre psychische Gesundheit auswirken und weshalb sie dem Selbstschutz Vorrang geben wollen, können negative Konsumentenreaktionen vermieden werden. Die Fans scheinen zu akzeptieren, dass Influencer – zumindest für eine gewisse Zeit – Pausen brauchen. Letztlich entscheiden jedoch die Konsumenten und nicht die Influencer darüber, ob die Gründe für eine solche Entscheidung plausibel sind. Hat sich ein Influencer zum Beispiel unpassend verhalten oder gegen selbstpostulierte Werte verstoßen, werden Follower wenig Verständnis aufbringen, wenn Kommentare plötzlich unterbunden werden.
> Auch Plattformbetreiber stehen in der Pflicht
Influencer sollten im Umgang mit Hasskommentaren jedoch nicht alleingelassen werden. Es liegt auch in der Verantwortung der Plattformbetreiber, sowohl Austauschmöglichkeiten als auch den Schutz der Privatsphäre sicherzustellen. Die Möglichkeit, Kommentare zu unterbinden, ist ein Anfang. Allerdings werden in der Öffentlichkeit stehende Personen häufig kritisiert, wenn sie diese tatsächlich nutzen. Doch Plattformen könnten im Rahmen des Plattform-Designs mehr gegen Hassrede tun und damit ihre Nutzer besser schützen. Zum Beispiel könnte es helfen, besser zu kommunizieren, dass die Deaktivierungsfunktion für Kommentare dazu da ist, Influencer vor psychischen Belastungen zu schützen. Bei Twitter/X erfahren Follower bislang nur, dass die Kommentarmöglichkeit für bestimmte Nutzergruppen gesperrt wurde; bei Facebook ist ersichtlich, dass sie für alle Nutzer deaktiviert wurde. In Zukunft finden sich vielleicht taktvollere Strategien, wie Plattformen die Nutzung der Deaktivierungsfunktion durch Influencer kommunizieren könnten, ohne negative Reaktionen auszulösen. Das wäre vor allem für Personen wichtig, die besonders häufig mit Online-Hetze konfrontiert sind, etwa aus marginalisierten ethnischen Gruppen und LGBTQ+-Communitys.
Plattformen könnten auch mit weiteren „Wellness-Funktionen“ experimentieren, zum Beispiel der Möglichkeit, die Zahl der erhaltenen Likes auszublenden. Das würde den ungesunden Vergleichsdruck unterbinden, ohne dass man Influencern gleich mangelndes Eingehen auf Konsumenten-Feedback vorwerfen könnte.
Wer die Bedeutung von Konsumenten-Feedback kennt, kann bessere Entscheidungen treffen
In der Öffentlichkeit stehende Personen müssen permanent abwägen, wie viel sie preisgeben, um ihr Image zu pflegen, ohne dabei ihre psychische Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Auch wenn das Bewusstsein dafür wächst, welche psychischen Belastungen Hasskommentare hervorrufen können, bleibt der Umgang damit schwierig. Sich „einfach“ zurückzuziehen und weniger erreichbar zu sein, etwa indem man die Kommentarfunktion deaktiviert, kann für Influencer und ihre Karriere negative Folgen haben. Schließlich sind Kommentare für Follower das Mittel, sich mitzuteilen. Obwohl das Unterbinden von Kommentaren kurzfristig Cyber-Mobbing verhindern kann und in dem Moment die psychische Gesundheit schützt, kann es Influencern längerfristig schaden und zu Ablehnung vonseiten der Follower führen. Die Entscheidung kann sich zudem negativ auf Markenpartnerschaften auswirken. 2023 haben Unternehmen Statista zufolge 34,1 Milliarden US-Dollar für Influencer Marketing ausgegeben. Das Wissen über die Folgen deaktivierter Kommentarfunktionen ist deshalb für Influencer und Markenpartner gleichermaßen relevant. Offene und ehrliche Kommunikation ist hier das Mittel der Wahl, um Konsumenten nicht zu verärgern und die Glaubwürdigkeit eines Influencers oder einer Influencerin zu bewahren. Einerseits können Influencer selbst das Thema psychische Gesundheit stärker in den Fokus rücken. Andererseits sollten auch Plattformen Funktionen zum Schutz der psychischen Gesundheit weiterentwickeln. In Markenpartnerschaften ist es wichtig, dass sich Influencer und Unternehmen regelmäßig über mögliche negative Folgen verschiedener Online-Dynamiken austauschen und gemeinsam die besten Lösungen entwickeln.
LITERATURHINWEISE
Daniels, M. E., & Wu, F. (2024). No comments (from you): Understanding the interpersonal and professional consequences of disabling social media comments. Journal of Marketing, 88(6), 121–139. https://doi.org/10.1177/00222429241252842
Statista (2023). Influencer marketing spending worldwide and in the United States in 2022 and 2023. https://www.statista.com/statistics/1414663/influencer-marketingspending-global-us/